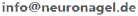Teil 2
Lynda und Michael Thompson
Funktionale Neuroanatomie: Netzwerke und Brodmann Areale
Die laterale Ansicht zeigt die Hirnlappen, Brodmann Areale und Elektrodenpositionen im 10-20 System (Gezeichnet von Amanda Reeves und Bojana Knezevic)
Die Nummerierungen der Brodmann Areale gehen von 1-52, aber man sollte nicht verzweifelt nach jeder Zahl suchen, weil es Sprünge gibt, von der 12 zur 17 und von der 47 zur 52. Und zwar deshalb, weil die BAs 14, 15 und 16 Zellregionen in insulären Hirnregionen von Primaten bezeichnen, die beim Menschen nicht vorkommen. Es fehlen also die betreffenden BAs. Ba 13 hingegen wurde von Neuroanatomen auch im menschlichen Cortex gefunden, wo diese Region als Brücke zwischen lateralen und medialen Arealen der Insula fungiert. Weil die Insula eine Einbuchtung des Cortex ist, ist sie weder lateral noch midsaggital sichtbar. BA 13 wurde im Handbuch Teil 1 in die Erläuterungen eingefügt, weil sie eine der Quellen in den LORETA Messungen ist und aus diesem Grunde den Neurofeedbacktherapeuten interessieren muss. Die BAs 49 bis 51 sind beim Menschen nicht vorhanden. BA 48 befindet sich hingegen im Subiculum, einem schmalen Teil der Oberfläche des Temporallappens der zur hippocampalen Region gehört, deshalb ist diese Region im Diagramm nicht sichtbar. BA 49 wird bei Nagetieren gefunden, die BAs 50 und 51 nur bei Affen. Die letzte Region, BA 52, wird dann wieder beim Menschen gefunden. Sie werden diese Region im superioren Temporallappen in der Nähe der Verbindung zwischen Frontal-Temporal und Parietallappen finden.
![]()
Medianschnitt zur Verdeutlichung der Hirnlappen, der Brodmann Areale und der Positionen des 10/20 Systems
(Gezeichnet von Amanda Reeves, Bojana Knezevic)
Anmerkung: Beide Diagrammen mit kurzen Anmerkungen zur Funktion der Brodmann Areale wurden zuerst als vierseitige Broschüre durch die International Society for Neurofeedback and Research (see
www.isnr.org), 2007, veröffentlicht. Diese Broschüre ist über die ISNR Webseite weiterhin erwerbbar. Die Gewinne aus den Verkäuifen kommen der ISNR Research Foundation zugute.
Das Ursprungsdokument war eine Gemeinschaftsarbeit von Michael Thompson, M.D. (ADD Centre & Biofeedback Institute of Toronto, Canada), Dr. Wu Wenqing (Friendship Hospital & Capital Medical University of Beijing, China) und James Thompson, Ph.D. (Evoke Neuroscience, New York, NY). Die Autoren erarbeiteten diesees Dokument als Zusammenfassung der Arbeiten von Korbinian Brodmann, die dieser in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts fertig gestellt hat. Sie verbanden die Originalkartierung des menschlichen Cortex durch Brdomann mit den neueren Erkenntnissen über funktionale Beziehungen der inzwischen allgemein üblich Brodmann Areale genannten Hirnregionen, die von unzähligen anderen Forschern erarbeitet wurden. Das Booklet war geschrieben worden, um die Mitarbeiter des ADD Centers Missisauga zu schulen, es wurde aber vom Sohn der Thompsons während seiner Zeit als Doktorrand an der Peensylvania State University, erweitert und vertieft, als er die Auswirkungen von Gehirnerschütterungen auf Sportlern erforschte. Das Manuskript wurde in der Absicht immer weiter ausgearbeitet, Neurofeedbacktherapeuten zu unterstützen, die nach den neuroanatomischen Ursachen bestimmter Phänomene suchten. Es gab allgemein ein starkes Bedürfnis unter Neurofeedbacktherapeuten nach weiterer Information, die in diesen Handbüchern, Teil 1 und Teil 2 an deutsche Therapeuten weiter gegeben werden sollen.
Dabei wird jedes Brodmann Areal mit seinen Verbindungen zwischen lokalen Funktionen und dem dazugehörigen Netzwerk erläutert
Man sollte im Gedächtnis behalten, dass jede Hirnregion mit mehreren Netzwerken und Brodmann Arealen verbunden ist. Kein Brodmann Areal hat eine unabhängige Funktion. Die meisten haben überlappende Beziehungen mit angrenzenden oder entfernten Brodmann Arealen. Tatsächlich sind ja alle von Brodmann gefunden Areale über verschiedene Netzwerke miteiander verbunden.
Der Zusammenhang zwischen menschlichem Verhalten und intrinischer Konnektivität von Netzwerken wurde dteailiert von Laird et. Al. 2011. detailliert beschrieben. Diese Publikation basierte auf 30000 MRI und PET Scans. Wer daran interessiert ist sollte Dr. Thatchers Zusammenfassung der Arbeiten von Laird et.al. lesen (Thatcher, Biver, & North, 2015) Lairds Arbeit definiert 18 spezifische Zusammenhänge von Lokalisationen und Funktionen. Die Erkenntnisse, die dort beschrieben werden, weichen nur selten von den Funktionen und Netzwerken, die in diesem Buch beschrieben werden, ab, es ist aber nützlich, eine ergänzende Perspektive zu haben, wenn man LORETA Z Score Training praktizieren will.
Primary Functions Related to General Areas of the Cortex
|
Drawing by Amanda Reeves, Bojana Knezevic, Maya Berenkey; Functional Areas by Michael Thompson
|
|
Gezeichnet von Amanda Reeves, Bojana Knezevic, Maya Berenkey; Funktional Areale von Michael Thompson Anmerkung zu den Illjstrationen: - Attention, Salience, Default, und Memory Netzwerke sind zu weit gestreut, um sinnvoll dargestellt zu werden.
- Brodmann Areal 32 ist eher exekutiv als affektiv, aber violett dient dem besseren Farbkontrast.
|
Diese zwei Diagramme geben einen Überblick darüber wie die Brodmann Areale zu bestimmten funktionalen Netzwerken in Beziehung stehen. Dieser Überblick ist sehr generalisiert und deshalb sicher etwas ungenau oder sogar fehlerhaft. Beispielsweise müsste die Regulation von Erinnerungen oder Emotionen sehr viel mehr Areale umfassen, als hier aufgeführt. Wir haben auch nicht jedes Areal mit der Aufmerksamkeit in Verbindung gesetzt, weil das fast alle genannten Areale umfasst hätte. Wir entschieden uns außerdem gegen Diagramme, um die linke und die rechte Hemisphäre zu zeigen, obwohl es einige Unterschiede in den Funktionen der dominanten und der nichtdominanten Hemisphäre gibt, die im Text ausführlicher dargestellt werden. Solche Details schienen uns unangemessen für einen generalisierten Überblick. Wir entschieden uns, gebräuchliche Bezeichnungen zu benutzen.
Die Funktionen von Brodmann Areal 40 können beispielsweise erst nach dem Lesen des Textes als unterschiedlich in der dominanten Hemisphäre (in erster Linie die Sprache betreffend – als Wernicke Areal, aber auch andere das Lernen umfassende Aspekte) und der nichtdominanten Hemisphäre (Intonation, Betonung, emotionale und nonverbale, aber auch räumliche Begründungen) verstanden werden. Viele Details werden erst verständlich, wenn man sich tiefer in den Text hinein arbeitet, die ersten Diagramme sollen dem Leser nur einen ersten Überblick ermöglichen.
Man sollte während des Lesens im Gedächtnis behalten, dass ein Brodmann Areal (BA) nicht notwendigerweise genau zu einem bestimmten Gyrus des Cortexes passt. Wie im ersten Handbuch haben wir auch diesesmal versucht Elektrodenpositionen des 10/20 Systems auf der Kopfoberfläche mit den Brodmann Arealen in Verbindung zu bringen. Dabei sollte klar sein, dass er individuelle Unterschiede und Variationen in der Topographie des Gehirns unterschiedlicher Menschen gibt. Es gibt auch entwicklungsbedingte Veränderungen der Hirnstruktur, vor allem im Hinblick auf die Maturation der Frontallappen, die bis zum Alter von 25 Jahren noch nicht abgeschlossen ist. In dem Augenblick, in dem die Anzahl myeliniserter Fasern zunimmt und die Frontallappen größer werden, gibt es eine deutliche Veränderung in der Lokalisation. Deshalb kann man oft das, was man beim Kind an Cz misst, beim Erwachsenen besser an FCz (liegt auf der Hälfte der Differenz zwischen Cz und Fz) messen. Brodmann sezierte die Gehirne von Erwachsenen, deshalb ist seine Kartographie an erwachsene Gehirne angepasst. Das muss man bei der Arbeit mit Kindern bedenken.. Außerdem wies Brodmann auf die Grenzen seiner Kartierung hin, die der Tatsache geschuldet ist, dass die Nummerierung der Oberflächen Gyri nicht die großen Areale der Hirnoberfläche, die sich in den Hirnfurchen- und Einbuchtungen finden, umfasst.
Lateraler Blick auf die linke Hirnhälfte.
Diese Zeichnung gewährt uns einen lateralen Blick auf die linke Hemisphäre. Sie stammt von Henry Gray.( Gray’s Anatomy of the Human Body, 1918). Dieser laterale Blick und der mediale unten sollen Sulci und Gyri zeigen, die in den anderen Diagrammen nicht benannt wurden.
Midsagittaler Blick auf die linke Hemisphäre
Gezeichnet von David Kaiser (Brodmannarea.info)mit Erlaubnis.
Die 19 Positionen, die im Folgenden eine Rolle spielen, sind blau eingezeichnet.
Cytoarchitektonik des menschlichen Gehirns, angelehnt an Brodmann (1909), (public domain)
Korbinian Brodmann sagte, “Eine Tatsache muss immer wieder deutlich betont werden: die funktionale Lokalisation und Kartierung des cerebralen Cortex ist ohne die ERrgebnisse der Anatomie, sowohl beim Menschen als auch beim Tier, unmöglich. In jedem Bereich stützt sich die Physiologie auf die Anatomie.”
Dr Korbinian Brodmann, Deutscher Neurologe (17 November , 1868 – 22 August, 1918)
Die Brodmann Areale (BAs) werden, wie im Handbuch Teil 1, in der Reihenfolge der Hirnlappen und der dazu gehörenden Position im 10/20 System aufgeführt. Das liegt daran, dass die Brodmann Areale funktional mit anderen Brodmann Arealen Überlappungen haben oder Funktionen teilen, manchmal auch mit Brodmann Arealen, die in größerer räumlicher Distanz liegen. Jedes Brodmann Areal ist meistens nur Teil eines komplexeren Netzwerks. Unsere Handbücher sind in der Absicht geschrieben worden, einige Funktionen bestimmter Netzwerke zusammenzufassen, bei denen man erwarten kann, dass sie auf Techniken des operanten Konditionierens durch Neurofeedback oder Biofeedback ansprechen. Wir entschieden uns dafür, die Funktionen der jeweiligen Brodmann Areale nicht aufzulisten sondern, wie im Handbuch Teil 1 in einer Tabelle am Ende des Buches darzustellen.
Es handelt sich bei den Handbüchern nicht um Lehrbücher der Anatomie. Der Text wurde geschrieben, um Menschen zu unterstützen, die Neurofeedback und Biofeedback praktizieren. Die Reihenfolge beginnt im Ursprungsmanuskript bei den Frontallappen und den Elektrodenpositionen Fz, F3 und F4. Die deutsche Übersetzung hingegen beginnt bei der Insula, dem Cingulum, den parietalen Regionen und den occipitalen Gebieten. Ursache war eine Kommunikationslücke zwischen Übersetzer und Autor. Somit ist unsere deutsche Reihenfolge: Insula, ACC, parietale Bereiche, occipitale Bereiche und erst dann folgen die in diesem Handbuch nachgereichten Frontallappen, dann zentrale Bereiche (Cz,Pz) undschließlich die Temporallappen.
Bitte behalten sie im Gedächtnis, dass sie, wenn sie diese Kapitel über funktionale Neuroanatomie mit ihrer Betonung auf Brodmann Areale lesen, dass jedes Brodmann Areal (BA) wiederum aus unterschiedlichen Zellgruppen besteht und dass hypothetisch jedes Areal zusätzlich zu seinen primären Funktionen viele andere assoziierte Funktionen umfasst. Dieses Handbuch Teil 2 und das Handbuch Teil 1 verbinden Informationen über die Brodmann Areale mit Elektrodenpositionen des 10/20 Systems. Die neueren Positionsbezeichnungen werden für temporale und parietale Areale benutzt, beispielsweise benannte man bisher die longitudinal Achse auf der linken Hemisphäre F7 – T3 – T5. Im Buch wird daraus F7 – T7 – P7. In der rechten Hemisphäre wurden die sequentiellen longitudinal Platzierungen F8 – T4 – T6 zu F8 – T8 – P8. Weil die meisten Datenbanken, die im Feld des Neurofeedback gebräuchlich sind, entwickelt wurden, bevor die Neurologen die Nomenklatur änderten, finden sich in den Handbüchern die alten und die neuen Bezeichnungen parallell: T3/T7, T4/T8, T5/P7, und T6/P8.
Die Beschreibung der Brodmann Areale und ihrer Funktionen führt uns zu neuronalen Netzwerken, die wir möglicherweise mit einer Kombination ausn Neurofeedback (NFB) plus Biofeedback (BFB) beeinflussen können.
Funktionale Überlappungen der Brodmann Areale
Die primären Funktionen der einzelnen Brodmann Areale (BA) werden im nächsten Abschnitt des Buches erläutert. Die beschriebenen Funktionen basieren auf klinischen Beobachtungen und sowohl publizierten als auch nicht publizierten Arbeiten anderer. Von Vorneherein ist klar, dass eine Funktionszuweisung zu einem einzelnen Brodmann Areal notwendigerweise falsch sein muss, weil alle Funktionen von der Interaktion mehrerer Areale abhängen und niemals einer einzeln agierenden Region zukommen. Es handelt sich nicht um eine moderne Form der Phrenologie (Lehre, die aus der Kopfform auf Persönlichkeitsmerkmale schloss). Dan Lloyd vom Trinity College, Hartford, CT, ist ein Experte für die Bordmann Areale. Er schreibt: “Das typische BA (Brodmann Areal) ist auf verschiedene Art und Weise an 40% des Verhaltens (kognitiv, perzeptiv, emotiv) beteiligt” (Lloyd, 2007, personal communication). Hinter dieser Beobachtung steht die Tatsache, dass jedes Brodmann Areal nur ein Areal von vielen repräsentiert, die an einem oder mehreren Netzwerken beteiligt sind, die cortikale-subcortikale Verbindungen aufweisen; deshalb wird jedes BA in die koordinierte Aktivität mit vielen anderen funktional verbundenen Arealen eingebunden, abhängig von der vom Gehirn zu bewältigenden Aufgabe.
Das könnte einer der Gründe sein, warum Neurofeedbacktherapeuten, die ein simples ein Kanal Training an einer Elektrodenposition wie Cz durchführten, gute Ergebnisse erzielen konnten. Cz liegt beispielsweise oberhalb von BA 4 (primärer motorischer Cortex), BA 4 liegt aber oberhalb von BA 24, dem anterioren Cingulum, das in mehreren Netzwerken von Bedeutung ist.
Training an Central Midline Structures
Annähernd 50% der EEG Amplitude unterhalb jeder einzelnen Ableitungsposition, wie etwa Cz, stammt von Neuronen, die unmittelbar unter der Elektrode liegen, 95% der gemessenen EEG Aktivität gehört zu Neuronen im Umkreis von 6 cm Entfernung von der Elektrode (Thatcher, 2012, Nunez et al., 1981, 1995, 2006). Training an „Central Midline“ Ableitungspunkten wie Cz, Fz und Pz beeinflusst höchstwahrscheinlich Schlüsselareale wie den Gyrus Cingularis, die an verschiedenen Netzwerken, wie z.B. dem Exekutiven-, dem Affektiven-, dem Salience- und dem Default Netzwerk, aber auch anderen, beteiligt sind.
Netzwerke synchronisieren die Funktion von Neuronengruppen in mehreren unterschiedlichen, aber miteinander verbundenen Abschnitten des zerebralen Cortex. Das Aufmerksamkeitsnetzwerk, beispielsweise, das ein Netzwerk des übergeordneten Exekutiven Netzwerks ist, wird wahrscheinlich vom Training an Cz beeinflusst. Dieses Netzwerk synchronisert aber die Funktionen von Neuronen im Frontal- und Parietallappen, dem anterioren Gyrus Cingularis, dem Hippocampus, den frontalen Augenfeldern und dem Sulcus Intraparietalis (Coul and Nobre, 1998). Zusätzlich scheinen Areale zu existieren, die die Aufgabe haben, das Gehirn von einem Netzwerk zum anderen umzuschalten. Beispielsweise ist das Default-Netzwerk ohne Aktivität, wenn das Aufmerksamkeitsnetzwerk arbeitet (Sridharan et al., 2008; Fox et al., 2005). Man vermutet, dass die Insula eine Schalterfunktion besitzt, die das Default-Netzwerk und das Aufmerksamkeitsnetzwerk im Wechsel an oder abschalten kann. (Sridharan, 2008).
Sowohl das Aufmerksamkeits- als auch das Default Netzwerk zeigen merklich schwächere Aktivität während des Schlafes. Der posteriore Gyrus Cingularis zeigt sowohl im Schlaf, als auch in der Narkose eine signifikante Deaktivierung. Diese Beispiele zeigen, wie komplex die Interaktionen der Hirnregionen sind, aber auch, wie es möglich ist, dass ein einzelnes Brodmann Areal zu unterschiedlichen Zeitpunkten an mehreren Netzwerken beteiligt sein kann.
Neurofeedback mit einer referentiellen Ableitung - aktive Elektrode an Cz, Referenz an einem Ohrläppchen – führte, unserer Erfahrung nach, in vielen Fällen zur Beeinflussung verschiedener Netzwerke. Das war möglich, weil Neurofeedback mehrere Areale beeinflusst, die im Anterioren Cingulären Cortex (ACC) liegen. Wie bereits erwähnt ist der ACC eine zentrale Struktur, die an vielen Netzwerken beteiligt ist, inklusive dem Exekutiven (auch Aufmerksamkeits-) Netzwerk, dem Affektiven (inklusive Gefahrerkennung) und dem Salience Netzwerk. Wir haben es uns angewöhnt von Netzwerken im Singular zu reden, aber tatsächlich ist jedes Netzwerk auch eine Gruppe von Netzwerken.
Wenn der Therapeut Neurofeedback zur Verbesserung der Aufmerksamkeit mit Biofeedback zur Entspannung kombiniert und das Herz Raten Variabitätstraining in sein Training einführt, werden Symptome, die eine Beziehung zu Ängsten haben, wahrscheinlich abnehmen. Wenn der Therapeut das Neurofeedbacktraining mit der Schulung von metakognitiven Strategien (lernen zu lernen) kombiniert, und so Aufgaben bezogen trainiert, wird eine Verbesserung der intellektuellen Leistungsfähigkeit und der im Intelligenztest erreichten IQ Werte zu beobachten sein, die einghergehen mit einem Anstieg der Aufmerksamkeitsspanne und der Konzentration. (Lubar et al., 1995; Thompson & Thompson, 1998; Thompson & Thompson, 2010).
Wir vermuten, dass man komplexe Netzwerke, die die unterschiedlichsten kortikalen und subkortikalen Areale umfassen, ansprechen muss, um solche weitreichenden Veränderungen der kognitiven und affektiven Funktionen mittels eines relativ simplen ein Kanal Training zu erzielen. Tatsächlich ist es möglich, dass ein Kanal Neurofeedbacktraining bei manchen Patienten einen theoretischen Vorteil gegenüber einem Training an mehreren Ableitungspunkten bietet. Durch den Einfluss auf ein Netzwerk von einem singulären Punkt könnte dieser eine Punkt es dem Gehirn erlauben die Abweichungen anderer Netzwerke zu kalibrieren.
Zusätzlich verhindert das Neurofeedbacktraining an einer Position, dass wir falsche Entscheidungen darüber treffen, welche Hirnbereiche beim Klienten „normalisiert“ werden sollen durch ein Z-Score gelenktes LORETA Neurofeedbacktraining. Man könnte argumentieren, dass ein Kanal Neurofeedbacktraining eine ausbalanciertere Methode ist, um das Hirn und seine Aktivität zu verändern. Es vermindert das Risiko, dass man Werte aus der Datenbank “verbessert”, die als kompensatorische Hirntätigkeit dienten oder gar als Zeichen einer besonderen Begabung. Dieses theoretische Dilemma kann nur durch jahrelanges Sammeln von Daten und zusätzliche Forschung ausgeschlossen werden.
Trotz alledem will der Anwender in komplexen Fällen präziser arbeiten und versuchen, Regionen des Gehirns zu beeinflussen, die tiefer im Gehirn liegen. Er möchte eventuell gleichzeitig mehrere unterschiedliche Parameter wie Amplitude, Phase und Kohärenz trainieren. In solchen Fällen benutzen wir LORETA Z-score Neurofeedback (LNFB).
Bedeutung von Netzwerken
Mittels Neurofeedback sind wir eigentlich immer damit beschäftigt, die Leistungsfähigkeit von neuronalen Netzwerken zu verbessern. Netzwerke sind Ketten von miteinander verbundenen Neuronengruppen, die Zusammenarbeiten um Ziele zu erreichen. In diesem Zusammenhang sollte man an den alten Spruch denken: Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Bei kortikaler Dysfunktion muss Neurofeedback entweder die Leistung der Verbindung verbessern oder dem Netzwerk dabei helfen, sich neu zu kalibrieren, um die Dysfunktion zu kompensieren. Das Gehirn besitzt Plastizität, die ihm eine solche Veränderung möglich macht, das wurde auch durch andere Verfahren bewiesen, die solche Verbesserungen erzielten. (Ein exzellentes Beispiel für die Spannweite neuoplastischer Veränderungen findet man in Norman Doidge’s 2010 Buch: The Brain that Changes Itself und der Fortsetzung 2015: The Brain’s Way of Healing.
Cortex-Basal Ganglien-Thalamus: Wie man das eine Netzwerk aktiviert – das andere hemmt
Um solche weitreichenden Effekte zu erzielen, muss das kortikale Areal, an dem wir mit Neurofeedback trainieren, die Fähigkeit besitzen, mit anderen funktional verbundenen Regionen, auch wenn diese räumlich entfernt sind, zusammen zu arbeiten. Gleichzeitig müssen funktional unerhebliche Areale des Cortex inhibitiert werden. Auf diese Art und Weise werden mehrere funktional verbundene kortikale Regionen synchronisiert und dazu gebracht als ein Netzwerk zusammen zu arbeiten, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen.
Das Gehirn versucht immer, Unsicherheit zu beseitigen und das Environment sowohl verlässlich als auch vorhersagbar zu machen. Es sucht nach Bedeutungen von Informationen und nach Mustern und geeigneten Assoziationen. Es analysiert unablässig Informationen auf ihre Bedeutung. Selbst wärend eines Assessment, sei es bei geschlossenen Augen, offenen Augen oder während einer Aufgabe, arbeitet das Gehirn des Klienten. Auch wenn wir von einem „resting“ state sprechen, gibt es in Wahrheit keinen Ruhezustand. Das Gehirn aktiviert unablässig spezifische Netzwerke. Sobald eine Person wach ist, aber noch kein Problem zu lösen hat, arbeitet das Default Netzwerk. Wie kommt es nun zur Abschaltung nicht benötigter Netzwerke, wenn die Aktivierung relevanter Netzwerke der Situation angemessen statt gefunden hat?
Inhibition
Lokale Inhibition spezifischer Pyramidenzellen findet unmittelbar nach dem Feuern einer Pyramidenzelle durch in der Nähe der Pyramidenzelle befindliche Korbzellen statt. Was ist also der zur Richtung der Aufmerksamkeit oder dem Auslösen einer spontanen Handlung, also für die Aktivierung eines Netzwerks bei gleichzeitiger Hemmung anderer, für diese Funktionen nicht benötigten Netzwerken, verantwortlicher Mechanismus? Ein verfügbarer inhibitorischer oder hemmender Mechanismus, der in der Lage ist, weit voneinander entfernte kortikale Areale zu aktivieren, sollte Verbindungen vom Cortex zu subkortikalen Strukturen besitzen, die allgemein Basalganglien genannt warden. Diese Verbindungen vom Cortex zu den Basalganglien und dann wieder zurück zum Cortex über den Thalamus, sind in der Lage aktiv zu sein, während sie gleichzeitig Areale, die für eine spezifische Aufgabe nicht benötigt werden, zu hemmen.
Die Basalganglien
Die Strukturen, die als Basalganglien bezeichnet warden zumfassen das dorsale Striatum, (Putamen und Caudate), den Nukleus Subthalamicus, die Substantia Nigra (pars compacta (SNc) der Dopamin produziert und den Pars reticulate (SNr), der ähnliche Funktionen wie das Palladium erfüllt) sowie einen limbischen Abschnitt, der den Nukleus accumbens (ventrales Striatum), das ventrale Pallidum und das ventral tegmentale Areal (VTA) umfasst. VTA transportiert Dopamin auf die gleiche Art und Weise zum Nukleus Accumbens (ventralen Striatum) auf dem die Substantia Nigra Dopamin dem dorsalen Striatum und dem Globus Pallidus zur Verfügung stellt.Man hört gelegentlich auch den Begriff: Nukleus lentiformis, was soviel bedeutet, wie: geformt wie eine Linse. Der Nukleus lentiformis umfasst das Putamen lateral und den Globus pallidus medial und die unbenannte Substanz, die die anterior perforierten Areale beinhalten, inferior.
Darstellungen, die dabei helfen, diese Formationen zu visualisieren.
Weiter unten werden mehrere Grafiken gezeigt, die dem Leser die Lage dieser Strukturen vor Augen führen. Vier dieser Grafiken wurden einem anderen Teil des Neurofeedback Book entliehen um dem Leser noch einmal die Beziehung zwischen den Basal Ganglien, dem Thalamus und dem Cortex zu verdeutlichen. Man sollte im Gedächtnis behalten, dass auf den Darstellungen dorsal zur Spitze des Kopfes hin bedeutet, aber im Hirnstamm und dem spinalen Bereich hinten. Ventral ist zur Schädelbasis hin, aber spinal würde es zur Vorderseite des Körpers gerichtet bedeuten. Lateral meint zu den Seiten und medial zur Kopfmitte. Dementsprechend ist ein medialer oder midsagittaler Blick ein Schnittbild durch die vertikale Ebene in der Kopfmitte von angterior (vorne) nach posterior (hinten)
Die obere darstellung ist eine L;ORETA Darstellung: Horizontal, Sagittal und Coronal. In der unteren Darstellung sind drei Dimensionen eines sagitttalen Schnittes aus dem LORETA Programm.
Diese Darstellung wurde einer NeuroGuide Analyse entnommen und zeigt die Schnittbilder, die man gezeigt bekommt, wenn man LORETA benutzt. Zu sehen ist eine LORETA Quellen Darstellung in Brodmann Areal (BA) 23, Cingulate Gyrus. Die Aktivität lag 2,5 Standardabweichungen über den Durchschnittswerten aus der Datenbank des neuroGuide Programms. Diese Aktivität zeigt eine exzessive Amplitude der 20 Hz Aktivität bei einer 42 jährigen frau, die unter Angstsymptomen litt (affektives Netzwerk)
Man sollte aber im Gedächtnis behalten, dass LORETA Bilder MRI Scans ähneln, aber mathematische berechnungen au seiner Oberflächenmessung sind. Für kortikale Ableitungspositionen besteht eine Verbindung zwoischen LORETA Quellen Lokalisation und MRT Scans. LORETA gibt aber keine Auskunft über subkortikale Orte.
Die obige Darstellung ist ein midsagittaler Schnitt, der die Position des Thalamus unterhalb des Gyrus Cingularis und des Corpus Callosum zeigt.
Die Darstellung weiter unten ist coronal, also ein tranversaler Schnitt, der die Beziehung zwischen Putamen, dem Globus Pallidus und dem Thalamus zeigt, wenn man vom rechtslateralen Aspekt des Cortex (einer Einfaltung, die Insula genannte wird), zum Zentrum des Gehirns schauen, wo wir das dritte Ventrikel erkennen. Dieselben Strukturen befinden sich spiegelbildlich in der linken Hemisphäre.
Schematisches Diagramm eines transversalen Schnitts durch die rechte zerebrale Hemisphäre (Amanda Reeves, after Smith 1962).
Die Darstellung unten zeigt die gleichen Strukturen und zusätzlich die Nuclei, die sie beeinflussen. Die Basalganglien und der Cortex werden direkt beeinflusst von der Substantia Nigra, die Dopamin produziert. Das folgende Diagramm beinhaltet die Basalganglien, den Thalamus und die Substantia Nigra.
Gray’s Anatomy (öffentliche Ausgabe). Schematisches Diagramm, eines transversalen Schnittes durch die rechte zerebrale Hemisphäre und die „midline structures“ (gemäß Smith 1962) , die den roten Nukleus, die Basal Ganglien und die Susbtantia Nigra zeigen (oft Subthalamus genannt).
Die nächste Grafik zeigt den Thalamus und gibt einen Überblick über dessen Projektionen zu unterschiedlichen cortikalen Arealen. Alle Sinneseindrücke, mit Ausnahme denen des Geruchs, passieren den Thalamus, ehe sie zum Cortex gelangen. Der Thalamus besteht aus zwei Lappen (dem linken Thalamus und dem rechten Thalamus , die bei 85% der Menschen verbunden sind durch die massa intermedia (gezeigt in den bisherigen Darstellungen) Diese gehen durch den dritten Ventrikel. Die Nuklei innerhalb des Thalamus projezieren zu spezifischen Arealen des cerebralen Cortex, wie im nächsten Diagramm gezeigt wird.
Anmerkung: Der Temporallappen (auf dieser Darstellung oben) wurde “aufgefaltet”, um das rot gezeichnete auditive Areal kenntlich zu machen.
Die Thalamischen Nuklei und ihre funktional bezogenen kortikalen Areale (adapiert von Smith, 1962)
Die obigen Darstellungen wurden angefügt, um den Leser auf die Besprechung der Ganglia-Thalamus-Cortex Schleifen vorzubereiten und um bildlich darzustellen wie einflussreich ein einzelnes kortikales Areal auf die Aktivierung eines neuronalen Netzwerkes sein kann,während sie gleichzeitig andere Areale hemmt. Um ein Beispiel zu geben: Feedback an Cz wird vielleicht BA 24 anregen und damit einen Teil des anterioren Cingulum, und LORETA NFB könnte dieses Areal vielleicht noch intensiver aktivieren. Wie wir weiter unten sehen werden, ist dieses Areal aber auch mit dem ventralen Striatum innerhalb der Basalganglien verbunden. Laterale Inhibition innerhalb des Striatum wird nun während des Neurofeedback dafür sorgen, dass ein spezifisches Netzwerk aktiviert wird, während andere Netzwerke, und damit Hirnregionen, die für diese spezielle Aufgabe unnötig sind, inhibitiert warden.
Stark vereinfacht könnte man sagen: das Putamen inhibitiert den Globus Pallidus (GP) (Pallidum). Der GP feuert nun in hoher Frequenz und inhibitiert seinerseits den Thalamus. Jede dieser drei Strukturen kann als funktionale Regelkreis des Gehirns verstanden warden. Somit, wenn beispielsweise ein motorisches Areal des Cortex ein spezifisch funktionales Areal des Putamen aktiviert, wird dieses Areal ein funktional darauf bezogenes Areal des Globus Pallidus inhibitieren. Diese Inhibitierung beendet nun das in hoher Frequenz den Thalamus inhibitierende Feuern des GP. Weil der Thalamus mit allen Regionen des Cortex verbunden ist, ist plötzlich nur noch der eine Aktivierungspfad offen, während alle anderen inhibitiert bleiben oder werden. Das Resultat ist, dass alle funktional mit dem offenen Pfad verbundenen Regionen (Netzwerk) aktiviert werden, während andere Netzwerke inhibitiert bleiben oder werden.
Nuclei des Thalamus
Weitere Diagramme können im Internet unter Human Neuroanatomy: An Introduction.James R. Augustine. (2008) Elsevier gefunden werden.
SECTION VII
Funktionale Netzwerke und Verhalten
Frontal-subkortikale Verbindungen
(Speziellen Dan an Tammy Binder, M.D.für die komplette Revision dieses Abschnitts)
Fünf Beispiele für kortikal-Basalganglienverbindungen
Netzwerkbeschreibungen wurden übernommen von Alexander et. al. (1986). Die farbigen Vierecke an der Spitze jeder Reihe repräsentieren kortikale Areale von links nach rechts: SMA (supplementary motor area); FEF (frontal eye field); DLPFC (dorsolateral prefrontal cortex); OFC (orbitofrontal cortex); ACC (anterior cingulate cortex). Die farblich nicht hervorgehobenen Kästchen repräsentieren subkortikale Strukturen:: GPi (internal segment of globus pallidus); MD (medial dorsal nucleus of thalamus); SNr (substantia nigra, pars reticulata); VA (ventral anterior nucleus of thalamus); VL (ventral lateral nucleus of thalamus). Bezeichnungen außerhalb der Kästchen repräsentieren “offene Loops” in Verbindung zum Netzwerk, die eventuell Verbindungen zum Striatum haben: APA (arcuate premotor area), EC (entorhinal cortex), HC (hippocampal cortex), ITG (inferior temporal gyrus), PPC (posterior parietal cortex), PMC (primary motor cortex), PSC (primary somatosensory cortex), und STG (superior temporal gyrus). Die Diagramme der Brodmann Areale wurden modifiziert, gemäß der 20th U.S. Edition von Gray`s Anatomie der menschlichen Körpers, verfügbar auf Wikipedia.
Das Striatum ist eine relative inaktive Struktur. Im Gegensat zum Segment des Globus Pallidus (GPi) und der Substantia Nigra Parts Reticulata (SNr) die in hoher Aktivität verharren, um tonische Inhibition spezifischer thalamischer Nuclei zu verhindern. Die Fünf Schleifen, die das Diagramm zeigt sind anatomisch auffällig, weil sie subkortikale Strukturen durchqueren. Sie werden gemäß ihrer Funktion oder des kortikalen Areals benannt.
Lange wurden die Frontallappen als das Zentrum exekutiver Funktionen angesehen, die Kropotov (2009) als Koordinatoren und Kontrollorgane motorischer und kognitiver Aktionen beschrieb, die die Aufgabe hätten, spezifische Ziele anzusteuern. Andere Komponenten exekutiver Funktionen inklusive der willentlichen Steuerung der Aufmerksamkeit, der Unterdrückung unangepassten oder unerwünschten Verhaltens, Planung, Entscheidungsfindung, Arbeitsgedächtnis, Beobachtung sowie das Rückmelden von Fehlern, um diese zu vermeiden, gehörten auch zu den Funktionen des Frontal Lappens.
Wie weiter oben dargestellt auf der Basis von Alexander et. Al. (1986) (Neuoroanatomie und Funktion) existieren fünf parallele frontal-subkortikale Schleifen. Jede Schleife besteht aus der gleichen Struktur: einem spezifischen Areal des frontalen Kortex, der zu spezifischen Arealen der Basalganglien projeziert, dann zum Thalamus, bevor der zur ursprümglichen Region des frontalen Kortex zurückkehrt und zu dessen functional bezogenen Regionen.
In seinem Buch: The Frontal Lobes and Voluntary Action, (Die Frontallappen und willentliche handlungen) von Richard Passingham (p. 220) vermutet der Autor, das das frontal-Basalganglien System an den Prozessen der Entscheidung “was zu tun ist…oder, welche Reaktion ist angemessen…) als Ganzes beteiligt ist.
‘Angemessenes’ Verhalten erfordert manchmal, dass abwägende, geplante Handlungen reaktiven, automatiserten oder einstudierten Handlungen, die rasch auszuführen wären, vorzuziehen sind. Stellen wir uns vor, ein Torwart beim Fussball beobachtet vor dem Abstoß, dass der gewohnte Anspielpartner gut abgeschirmt ist, dass aber einer der Stürmer relkativ nah am gegnerischen Tor steht, ohne im Abseits zu sein. In dieser Situation ist der Torwart gezwungebn, die automatisierte und gewohnte Handlung zu unterbrechen und einen weiten Abschlag zu planen und durchzuführen. Wie aber macht sein Gehirn das?
Unser Gehirn bereitet oftmals parallel mögliche, sinnvolle Handlungspläne vor. Im oben beschriebenen Fall muss der weite Abschlag zum gut positionierten Stürmer dem gewohnten und automatiserten Abschlag zur Mittellinie vorgezogen warden. Um das zu schaffen, muss das gehirn dazu in der Lage sein, alle möglichen handlungsplne zu verwerfen, bis der in dieser Situation beste Handlungsplan gefunden ist. Das Gehirn schafft das, indem es flexible Bewegungspläne generiert. Diese bereitgestellten Handlungsmöglichkeiten oder Handlungspläne helfen dabei, zu verhindern, dass immer der automatiserteste Handlungsplan durchgeführt wird. Das Takten von Bewegungsplänen bis der für den Erfolg wahrscheinlichste Plan gefunden ist, ikst ebenfalls wikchtig, um vermengte Handlungsmuster zu vermeiden, bei denen zweoi oder noch mehr motorische handlungspläne zur gleichen Zeit bereit getsellt warden. Im Falle des Torwarts würde das dazu geführt haben, das ser unentschlossen den Ball irgendwo zwischen Mittellinie und Stürmer ins Nirgendwo geschossen hätte, was sicher kein gewünschtes Ergebnis gewesen ware.
Die Organisation von multiplen parallelen Schleifen durch die Basalganglien, zusammen mit von den Basalganglien ausgehenden Inhibitierungen des Thalamus, dienen dazu, eine möglichst große Zahl von möglichen Handlungen voir zu programmieren. Denken sie daran, dass die Feuerrate des GPi (dem internen Segment des Globus Pallidus) und dem SNr (Substantia Nigra, Pars reticulata) hoch ist und zur tonischen Inhibition thalamischer Neuronen führt. Mit anderen Worten, in der Baseline sind die Tore geschlossen.
Stellen wir uns nun kortikale Plämne vor, die exzitatorische Projektionen zum Striatum senden. Jeder handlungsplan aktiviert striatale Neurone in ihrem jeweiligen abgegrenzten Kreis. Diese feuerbereiten striatalen Neuronen inhibitieren striatale Neuronen in anderen Kreisen oder Loops, (die aktiviert würden von alternative Handlungsplanungen), durch laterale Inhibition, auf diese Art und Weise können verschiedene Handlungspläne im Wettbewerb stehen. Zur gleichen Zeit inhibitieren die striatalen Neuronen des „Weges zum Erfolg“ auch die tonisch aktiven GPi Neuronen ihres eigenen Loops, was ein Aussetzen ihrer Aktivität bewirkt. Diese Pause in der Aktivität der GPi Neuronen verhindert die Inhibition der thalamischen Zellen des gleichen LOOPS. Die folgende Erregung (Aufhebung der Inhibition) der thalamischen Zellen, verursacht ein exzitatorisches Signal zurück zu den Arealen des Frontallappen, die den erfolghversprechenden Handlungsplan generiert haben – ein Go Signal – das nun dazu führt, das die entsprechende handlung auch ausgeführt wird.
Ich möchte Sie aber daran erinnern, dass die obige Darstellung eine starke Vereinfachung ist. Tatsächlich sind beisopielsweise Neuronen, die ein Go Signal vom Thalamus zur Ausführung eines Handlungsplans erhalten im gleichen kortikalen Areal, aber in anderen Layern oder Lagen als die Neuronen, die den Plan generierten. (Halten sie im Gedächtnis, dass der Kortex aus sechs Lagen besteht) Mehr Details finden sie bei Brown et al. (2004).
Kommen wir nun zur näheren Betrachtung der Circuits oder Loops
Motorische Schaltung
Der Motor Circuit (motorische Schaltung?) ist an der Planung, Ausführung und Inhibition willentlicher Körperbewegungen beteiligt. Unterbrechungen dieses Circuits (dieser Schleife) führen, egal in welchem Bereich sie stattfinden, zum Verlust motorischer Kontrolle, wie man sie bei klinischen Krankheitsbildern wie Parkinson beobachten kann, einer Krankheit, bei der Dysfunktionen des Basalganglien in exzessiver Inhibitierung der Willkürbewegungen führen, der so genannten Bradikinäsie (verlangsamte Bewegung) die als ein Problem beim Öffnen der Bewegungsgates verstanden werden kann oder ebenso als unangemessenes Öffnen von Bewegungsgates, was zu Tremor führt.
Okulomotorische Schaltung
Die oklulomotorische Schaltung ist an der Planung und Durchführung von willentlich gesteuerten Augenbewegungen beteiligt. Unterbrechungen an irgendeinem Punkt dieser Schaltung hat Einfluss auf die Fähigkeit bewusst ein bestimmtes Objekt oder einen Ort zu fixieren, während man der natürlichen Neigung den Blick zu anderen Objekten oder Bewegungen zu schwenken widersteht. Diese Schaltung ist außerdem notwendig, um den Blick zu erinnerten Orten oder gegenständen zu steuern.
Dorsolateral er Präfrontaler Kortex (Exekutive) Schaltung
Der dorsolaterale präfrontale Kortex ist an vielen Aspekten exekutiver Funktionen beteiligt, inclusive der Fähigkeit komplexe Probleme zu lösen, voraus zu planen, Aufmerksamkeit zu fokussieren und zu halten, Aktionen zu steuern um Anforderungen zu leistern, und die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, wenn die Schwierigkeit der Anforderungen sich verändert. Er spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle beim Arbeitsgedächtnis: der Fähigkeit Dinge lange genug im Gedächtnis zu behalten, um eine Handlung danach auszurichten, etwa eine Telefonnummer lange genug im Gedächtnis zu behalten, um sie wählen zu können. Patienten, die an einer Unterbrechung irgendeines Punktes der dorsolateralen präfrontalen Schaltung leiden, zeigen das klassische dyspraktische Syndrom, das charakterisiert wird durch Starre, Perservation, Unaufmerksamkeit und Desorganisertheit, mit schlechten Erinnerungsfähigkeiten, schwacher Argumentationsfähigkeit und reduzierter geistiger flexibilität. (Tekin and Cummings, 2002). Oft sind sie beeinträchtigt bei den Aufgaben des Stroop Tests, die erfodern, dass automatiserte Lesen von Wörtern unterdrücken muss, um die Farbe zu benennen, in denen das Wort geschrieben steht. Das wird für solche patienten zu einer Herausforderung, weil es einen Konflikt zwischen Wortbedeujtung und der Farbe in der das Wort geschrieben wurde gibt. Wenn eine Person beispielsweise das Wort ROT in großen Druckbuchstaben sieht, dieses aber in blau geschrieben ist, wäre die korrekte Antwort eben: blau. Das erfordert die Fähigkeit die starke Tendenz das Wort einfach nur zu lesen zu unterdrücken – oder zu kanaliseren- die dazu führen würde, als Antwort. rot zu sagen.
Orbitofrontaler Kortex (Social) Circuit
Der orbitofrontale Kortex“ist die neokortikale Repräsentation des limbischen Systems” (Bonelli and Cummings, 2007). Der orbitofrontale Circuitleitet das empathisch und sozial angemessene Verhalten (Chow and Cummings, 1999) und vdie unterschiedlichsten Objekte und Handlungen unterliegen dieser subjkektiven Bewertung (Dranias, 2008). Bschädigungen dieser Schaltung führt zu Verhaltensänderungen, emotionaler Labilitätz, Enthemmung, schwacher Urteilskraft und Unzuverlässigkeit gegenüber der Familie und den sozialen Verpflichtungen (Bonelli and Cummings, 2007). Ein Patient mit einer Beschädigung dieses Areals ist eventuell nicht mehr in der Lage soziale Normen zu akzeptieren, die einen hungrigen Menschen davon abhalten ohne zu fragen vom Teller seines Gegenüber zu essen, wenn ihm danach zumute ist. Und hzwar deshalb, weil der Wert eines angepassten sozialen Verhaltens sein eigenes Verhalten nicht mehr bestimmt, so dass der Impuls zu essen, wenn man hungrig ist, nicht mehr durch Reflexion oder internaliserte soziale Norm gebremst wird.
Anteriorer Cingulärer Kortex
(Affektiver) Circuit
De anteriore cinguläre Kortex (ACC) besteht aus verschiedenen funktionalen Bereichen (Nee et al., 2011) wie man auf dem Diagramm der Central Midline Structures das am Anfang des nächsten Kapitels zu finden sein wird, erkennt.
i)Der Prä- und subgenuale ACC(PACC) istvermutlich mit emotikonalen Netzwerken verbunden, die aktiviert werden, wenn ein Fehler bei einer erbrachten Leistung auftritt. Brodmann Areal 25 ist Teil des PACC, ein Areal, dass besonderes Interesse erweckt hat, weil es fast immer Überaktiviert ist bei depressiven Patienten. Bemerkenswerte Zurückbilduing von schweren, behandlungsresistenten Depressionen erfolgten, wenn diese abnormal hohe Aktivität unterbrochen wurde durch Tifenhirnstimulation (DBS) (Mayberg et al., 2005; Holtzheimer and Mayberg, 2011). Es scheint so, als ob DBS also Tiefenhirnstimulation das Gate in BA 25 schließt, das die Überflutung mit negativen Emotionen und Zuständen steuert. (Siehe Dobbs, 2006, um eine lesbare Historie diese Behandlungsform zu nennen.) Neurofeedback in Verbindung mit Psychotherapie war nachweislich abenfalls in der Lage BA 25 und damit andere mit der Dewpression verbundene Areale zu beeinflussen. (Paquette, 2009).
ii) Ein eher dorsales Areal des ACC, auch rostrale cinguläre Zone genannt (RCZ) oder supragenualer ACC (SACC) besitzt einen anterioren Teil der an der Steuerung des Bewusstseins voraussichtlicher Fehler beteiligt ist, wenn erhöhte kognitive Kontrolle erforderlich ist. (Brown and Braver, 2005). Eine solcherart initialisierte erhöhte Vigilianz oder ein erhöhtes Arousel erreicht dann über ACC Projektionen den Locus Coreruleus (LC) des Hirnstamms, (Aston-Jones and Cohen, 2005) Veränderung der Reaktionsbereitschaft vieler Neuronen die kognitive Performanz ermöglicht. Es besteht eine umgedreht U förmige Beziehung zwischen der tonischen Locus Coeroleus (LC) Aktivität und der Leistungsfähigkeit bei der Lösung von Aufgaben die eine erhöhte fokussierte Aufmerksamkeit erfodern. Das bedeutet, das schlechte Leistungsfähigkeit sowohl bei niedrigem (underarousal) als auch bei hohem (Angst) Tonus der LC Aktivität entsteht. Optimale Leistungsfähigkeit entsteht bvei moderater tonischer LC Aktivität, die langanhaltende phasische LC Aktivierung als Antwort auf Ziel relevante Stimuli ermöglicht. (Aston-Jones and Cohen, 2005; Sara and Bouret, 2012, LC effects on cognition). Es gibt also viele Hinweise, die nahelegen begründeterweise zu vermuten, dass ACC/LC Interaktionen eine bedeutende Rolle dabei spielen, das eigene Arousal und die eigene Aufmerksamkeit selbst zu regulieren, um Herausforderungen angemessen zu begegnen.
Große bilateral Läsionen des ACC führen zu akinetischem Mutismus, der als ein Zustand der Wachheit bei bestehendem geminderten Arousal und einer tiefgreifenden Apathie betrachtet wird. (Bonelli and Cummings, 2007). Solche Patienten sprechen und bewegen sich selten spontan und zeigen nur geringe Reaktionen auf direkte Fragen und Nachfragen. Sie sind unempfindlich gegenüber Schmerz, Durst oder Hunger. Deshalb wurden neurochirurgisch absichtlich Läsionen im ACC von Patienten verursacht, die an andauernden und untherapierbaren Schmerzen litten. Menschen mit Beschädigungewn des ACC Circuit sollen, wie berichtet wird, oft eine deutlich verminderte Fähigkeit zeigen, neue Gedanken aufzunehmen oder weiterhin an kreativen Denkprozessen teil zu haben. (Chow and Cummings, 1999).
iii) Der posteriore Teil des SACC ist eher mit den Netzwerken für die Motorik verbunden und könnte in Funktion treten, wenn Ungewissheit oder ein Konflikt eine angemessene Antwort auf eine Herausfoderung notwendig machen. (Nee et al., 2011). Das wäre zuim Beispiel mein Go/No-Go task, be idem der Proband einen Knopf immer nur drücken soll, wenn er auf einem Bildschirm beispielsweise ein A erkennt, er muss aber seine Reaktion bremsen, wenn ein B erscheint. Indiesem Falle darf er NICHT den Knopf drücken. Normalerweise wird den Probanden sehr oft das A präsentiert, um eine Prädisposition zum XDrücken des Knopfes zu erzeugen, die dann unterdrückt warden muss, wenn ein No Go Durchlauif erfolgt, also ein B erscheint. Menschen mit Läsionen im ACC zeigen neben der Apathie auch Probleme beim Durchführen dieser Tests.
Go vs. No-Go: Direkte, Indirekteund HyperdirekteVerbindungen
Angemerkt werden muss, dass die bisherigen Schaltungsdiagramme sich immer auf direkte Verbindungen zu den Basalganglien bezogen und speziell darauf, wie diese Go Signale generieren. Es gibt aber auch inidrekte oder NO GO Verbindungen deren Neuronen die Neuronen der direkten Verbindungen (innerhalb des Streifenkörpers oder Striatum) und die ebenso tonisch aktive Neuronen des externen Segments des Globus Pallidus (GPe) inhibitieren. Der GPe inhibitiert verschiedene Strukturen tonisch, aber nur sein Output zum Nukleus (STN) wird unten dargestellt. Aktivierung des indirekten Pfades kann somit zu angehobener Aktivität im STN (durch Disinhibition) führen, während der hyperdirekte Pfad den STN unmittelbar aktiviert.
Angehobene STN Aktivität ist in der Lage, No Go Signale zu generieren, indem sie glutaminerge exitatorische Inputs zu den Neuronen des GPi/SNr sendet und sozusagen nebenbei die thalamische Inhibition verstärkt. Erinnern wir uns: der „direkte“ Pfad hat den gegenteiligen Einfluss auf das GPi/SNr: kortikale Signale wandern durch das Striatum um vorübergehend Zellen des GPi/SBr zu inhibitieren, was zur vorübergehenden Disinhibition des Thalamus führt. Den einander zuwiderlaufenden Effekte direkter „Go“ und indirekter sowie hyperdirekter „No-Go“ Verbindungen auf den GPi/SNr warden unten gezeigt.
![]()
Vereinfachte frontal-subcortikale Schaltungen die ausgewählte Aspekte direkter, indirekter und hyperdirekter Pfade darstellen. DSimplified frontal-subcortical circuits illustrating selected aspects of the direct, indirect, and hyperdirect paths. Die Aktivierung von striatalen Neuronen in den direkten Verbidnungen führen zur Inhibition von Neuronen von internen Segmenten des Globus Pallidus (GPi) sowie der Substantia Nigra Pars Reticulata (SNr). Aktivierung von striatalen Neuronen des indirekkten Pfades führen zur Inhibition von tonischer Aktivität in externen Segmenten des Globus Pallidus (GPe). Diese Inhibition des GPe disinhibitiert den subthalamischen Nukelus (STN), der dann einen exzitatorischen Impuls an den GPi/SNr leitet. Der frontale Cortex kann zudem STN Zellen direkt exzitatorisch anregen über den hyperdirekten Pfad.
Wenn zusätzlicher exzitatorischer Einfluss auf die GPi/SNr Neuronen dazu kommt, steht dem eine hohe STN Aktivität entgegen die zeitweise die Inhibition des GPi/SNr über den direkten Pfad übertrifft. Auf diese Art und Weise ist die STN Aktivität dazu in der Lage, Prozesse zu verlangsamen und eventuell auch die Disinhibition des Thalamus durch den direkten Pfad verhindern, was zu einer Unterbrechung der Weiterleitung eines „Go“ Signals zurück zum Cortex unterbricht.
Tatsächlich wird eine abnormal hohe Aktivität des STN bei der Parkinson Erkrankung beobachtet, die mit den verlangsamten Bewegungen des Patienten bei dieser erkrankung zusammenhängt. Das Wissen um diesen Kreislauf führte zur Entwicklung von neurochirurgischen Techniken, inkusive der Tiefenhirnstimulation (DBS) des STN um spzeiell die pathologisch starken 2No Go” Signale im PD zu untzerbrechen.
Normalerweise sind “No-Go” Signale wichtig, um ein Verhalten zu unterbrechen, wenn neue Informationen, etwa neue Ziele oder Aufgaben, zur Verfügung stehen. Um auf das Beispiel des Torwarts zurück zu kommen, der einen Abstoß zur Mittellinie machen wollte, und dessen motorische Programme zur Ausführung bereits anliefen. Das bedeutete, dass das Programm zu diesem Schuss im direkten Pfad des Striatum „siegreich“ gewesen ist. Als er aber im letzten Augenblick den Stürmer mit der exzellenten Anspielposition erkannte, traten „No-Go“ Mechanismen in Kraft, die in der Lage waren, das laufende motorische Programm zu unterbrechen.
Eine der “No-Go” Mechanismen der wahrscheinlich wichtig für die Verhaltensunterbrechung und zum Switchen zu einer neuen Aufgabe bedeutsam ist umfasst starke Projektionen vom Thalamus zum Streifenkörper oder Striatum. Neuronen des centromedian-parafascicula Komplex (CM/Pf) des Thalamus werden bei unerwarteten ausgeprägten Stimulie aktiviert und projezieren zu striatalen cholinergen Interneuronen. Die Aktivierung diese striatalen cholinergen Interneuronen (bekannt als tonisch active Neuronen oder TANS) produziert vorübergehend angehobene Aktivität des indirekten Pfades und abnehmende Aktivität des direkten Pfades. Dieser Schwenk des Prozesses zugunsten der Aktivität des indirekten Pfades führt zur Unterbrechung des laufenden motorischen Programms und zur vorübergehenden Unterbrechung der Bewegung. (Minamimoto, 2008; Ding, 2010; Tan and Bullock, 2008, Smith, 2011). Als Folge kann eine neue Aktivierung des direkten Pfades des Striatums in Gang gesetzt werden. In dieser neuen striatalen Wettbewerb der Aktionen kann die höhere Möglichkeit des Erfolgs eines langen Passes zum frei stehenden Stürmer gegen die motorische Routine des gewohnten Abschlags gewinnen und der lange Pass wird ausgeführt.
Zusätzlich zum Schwenk zwischen Möglichkeiten und der Unterbrechung laufender Verhalten spielen inidrekte und hyperdirekte Pfade wahrscheinlich eine wichtige Rolle in der Verzögerung gewollter Handlungen, in der Verhiinderung von siegreich ausgewählten Handlungsmsuern vollends durchgeführt zuwerden, die verhinderung von begonnenen motorischen handlungen um Perservation zu verhindern sowei das anschließende motorische Programm einzuleiten in einer flüssigen handlungsabfolge. Die letzten beiden Aufgaben wurden in ein Computermodell der Sprachproduktion aufgenommen, wenn Läsionen ( bei abnormal hohen Dopamin Leveln im Striatum oder bei spezifischen und lokalisierbaren Abnormalitäten der weißen Substanz) für mehrere Formen des Stotterns sorgen. (Civier et. al, 2013).
Shifts in der relative Aktivierung von direkten, indirekten und hyperdirekten Pfaden verursachen vermutlich auch die Abwägung zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit, ein lange beobachtetes Verhaltensphänomen be idem die Forcierung schneller Entscheidungen zu einem Verlust an Genauigkeit führt, während die Betonung der Genauigkeit bei Entscheidungsfindungen zu langsameren Reaktionen führt. (Bogacz, 2010, zum nachschlagen).
Man muss anmerken, dass eine Dopaminerhöhung Aktivität im direkten Pfad erhöht (über exzitatorische D1 Rezeptoren auf striatalen Neuronen im direkten Pfad) und gleichzeitig im indirekten Pfad (über inhibitorische D2 Rezeptoren auf striatalen Neuronen im indirekten Pfad) senkt. Der Netzeffekt bevorteilt direkte gegenüber indirekten Pfaden. Auf diese Art und Weise ist Dopamin im Striatum in der Lage, Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Zu viel Dopamin hingegen kann anormale Leistung verursachen. (Civier, 2013.)
Mechanismen, die den indirekten Pfad und den hyperdirekten Pfad bevorzugen haben den gegenteiligen Effekt und können zum Absinken der leistungsfähigkeit führen. Erinnern sie sich an das Beispiel der abgesenkten Aktivierung von GPi/SNr durch das STN. Je aktiver GPi/SNr Neuronen werden, desto mehr werden Outputs vom direkten Pfad, die starker als gewöhnlich sind, inhibitiert (um den Thalamus zu disinhibitieren und ein “Go” Signal zurück zum Kortex zu generieren. Die größere Zeitspanne, die es dauert, dieses Output, das starker als gewöhnlich ist des direkten Pfades zu erzeugen, führt zu nachlassender und verlangsamter Leistung. Zur gleichen Zeit gibt diese Verzögerung Mechanismen im Striatum einen größeren zeitlichen Spielraum zu agieren und erlaubt dadurch später ankommenden oder zeitweise schwächeren Inputs eine bessere Chance wettbewerbsfähiger zu sein und in der Aktivität stärker zuzunehmen als es ihnen ansonsten möglich wäre, wenn schnelleere Reaktionen erforderlich wären.
Denken sie noch einmal an den Stroop Test, be idem das rasche lessen von Wörtern in Konkurrenz zum langsameren Prozess des Benennens der Farbe in der das Wort geschrieben ist stehen, speziell wenn ein Unterschied zwischen der Bezeichnung einer Farbe durch ein Wort und der Druckfarbe des Wortes besteht. Wenn wir das Wort „ROT“ beispielsweise in großen, blauen Buchstaben geschrieben sehen werden zwei mögliche verbale Reaktionen im Kortex vorbereitet und in zwei miteiander konkurrierenden Befehlen zum Striatum geschickt. Weil der Pfad des Lesens von Wörtern automatisierter ist, ist er der schnellere und deshalb wird der verbale Plan für das Lesen von “ROT” schneller generiert und beginnt rasch die Ausgangsneuronen des direkten Pfades im Striatum zu aktivieren. Wenn an diesem Punkt des Reaktionsablaufs die striatalen Neuronen genügend aktiviert sind, um die GPi/SNr Aktivität zu mindern (inhibitieren), wird ein „Go“ (Start) Signal zurück zum Kortex gesendet, und die Person wird eine unerwünschte Reaktion zeigen, indem sie das gelesene „Rot“ sagt und die Farbe des Wortes übersieht.
Andererseits, wenn der exzitatorische (erregende) Antrieb des STN (Striatum) die GPi/SNr Aktivität steigert, wird ein höheres Aktivierungsniveau der striatalen Neuronen benötigt, um ein “Start” Signal zu generieren, das auslösende Aktivitätsniveau der striatalen Neuronen der direkten „ROT“ Pfade wäre nicht mehr ausreichend. Auf diese Art und Weise hat das höhere GPi/SNr Aktivitätslevel eine höhere Reaktionsschwelle gesetzt, die die spontane Reaktion: “ROT” zu sagen unterdrückt und dem später ankommenden striatalen Befehl mit der Farbe des Wortes: Blau zu antorten eine Möglichkeit gibt, ausgeführt zu werden.
Beachten wir, dass die Schwierigkeit der Aufgabe – in diesem Falle die Anweisung die Farbe des Wortes zu sagen – höchstwahrscheinlich im lateralen präfrontalen Kortex enkodiert wird. Solange die Anforderung, die eine Aufgabe stellt, im Gedächtnis ist und dieses die Aktivität bestimmt, werden kontextbezogene Signale generiert und kortikale und striatale Wettbewerber zu korrekten verbalen Ausformulierung: „Blau“ verhindert. Zusammenfassend kann man festhalten, das seine gute Leistung im Stroop Test am Ende drei Fähigkeiten erfordert: eine ausreichend hohe Reizschwelle, die schnelle, aber falsche Antworten verhindert, die Fähigkeit Aufgabenstellungen im Gedächtnis zu behalten und genügend Zeit zum Lösen der Aufgabenstellung, die dabei hilft, die langsamere, aber korrekte Reaktion auf ein genügend hohes Aktivitätslevel zu bringen, um den kortikalen und striatalen Wettbewerb zu gewinnen.
Erinnern sie sich an die vorhergehende Beschreibung des anterioren cingulären Kortex (ACC) der an der Beobachtung von eigenen Handlungen und der Fehlerkorrektur beteiligt ist. Diese Aufgaben veranlassten Frank (2006) zu der Vermutung, dass ACC Inputs zum STN der Mechanismus sein könnte, der die Anhebung der Reizschwellen für Antworten erhöht, wenn Fehler wahrscheinlicher werden und langsamere, aber genauere Antworten sinnvoller sind. Während die Hypothese über die hyperdirekten Pfade momentan ein allgemein akzeptiertes Modell ist, müssen andere “No Go” Mechanismen wie die vorhin beschriebenen centromedian-parafaszikularen Komplexe (CM/Pf) erst noch beweisen ob sie ähnlich oder sogar noch wichtiger sind.
Bedeutung dieser Pfade zur Produktion des SMR
An diesem Punkt ist es von Interesse, auf die Wahrscheinlichkeit hinzuiweisen, dass der senso-motorische Rhythmus (SMR) von No-Go Zuständen der Basal Ganglien stammt und dass das SMR Training die Fähigkeit steigert, willentlich diese NoGo Zustände zu erzeugen. Das stimmt mit der Feststellung (siehe Sterman and Thompson, 2014) überein, dass SMR mit Unbeweglichkeit zusammen hängt und anfänglich beobachtet wurde, wenn Katzen eine vorher erwünschte Reaktion unterdücken mussten. Die Feststellung (Boulay et al. (2011)), dass die Reaktionszeit SMR Produktion bei Go/NoGo Aufgaben erhöht (i.e. verlangsamte Reaktionszeit während hoher SMR Produktion und kürzere Reaktionszeit bei niedriger SMR Produktion.) sind genau das erwartete Ergebnis, das man bei bei den Reaktionen der Basalganglien bei Go/NoGo Tests auch erwarten würde. Die Behauptung, dass SMR während NO-Go Zuständen produziert wird, stimmt mit der Beobachtung überein, dass die fMRI Aktivität im Striatum angehoben ist, während der Produktion von SMR (Birbaumer, nicht publizierte Resultate, berichtet von Sterman und Thompson, 2014), und nach erfolgreichem SMR Training, in der Leistung beim Stroop task (Levesque et al., 2005). Weil das Striatum als “leise” Struktur bekannt ist, weil zu jeder Zeit nur geringe Anteile der Neuronen aktiv sind, ist es wahrscheinlich, dass diese fMRI Ergebnisse inhibitorische No-Go Prozesse reflektieren, die im Vergleich zu eher fokalen „Go“ Pfaden, eher synchron und über weiten Arealen ausgedehnt sind. (Bullock et al., 2009).
Die Beobachteung, dass das SMR Training im Grunde striatles No-Go training ist, stimmt mit allem überein, was man über die der SMR Produktion zugrunde liegenden Mechanismen weiß. Der Rhythmus selbst entsteht durch Interaktionen zwischen zwei Neuronenpopulationen innerhalb des Thalamus: inhibitorischen Neuronen im retikularen thalamischen Nukleus (thalamic reticular nucleus (nRT) ) und excitatorischen thalamocortikalen Neuronen im verntrobasalen Komplex (ventrobasal (VB) complex).
Eine bedeutende Eigenschaft thalamischer Neuronen, deren Funktion einer großen Bandbreite kortikaler Ryhthmen zugrunde liegt, ist die, dass sie, wenn sie stark genug inhibitiert warden, von tonischer Aktivität zum aktiven Feuern übergehen. Im Falle des SMR Rhythmus bedeutet das, dass die erzeugenden Neuronen wenn sie im verntrobasalen Komplex ausreichend inhibitiert werden, hyperpolarisieren. Sie verlassen den zustand der Hyperpolariserung mit einem Burst an Aktivität, der nahegelegene nRT Neuronen erregt. Das führt dazu, dass die VB Neuronen erneut hyperpolarisieren und dass der Zyklus von vorne beginnt. Auf diese Art und Weise wird eine alternierende Aktivität zwischen beiden thalamischen Nuklei in Gang gehalten. Weil VB ebenfalls exzitatorische Projektionen zum primären somatosensorischen Cortex (S1) sendet, führt die oszillatorische Aktivität im VB zu oszillatorischer Aktivität an S1, die mittels des EEG gemessen werden kann. Die thalamocortikalen Osziallationen, die dem SMR Rhythmus zugrunde liegen, sind schon lange bekannt. Weniger klar ist, was den Prozess auslöst, bei willentlich herbeigeführter SMR Produktion. Das zur Erzeugung von SMR notwendige Verhalten wird begleitet von „no go“ Aktivität in den Basalganglien. Interessant ist die tatsache, des “no go” indirekten Pfades zum nRT projeziert (Bullock, 2009). An der Baseline sorgt GPe für tonische Inhibition zum nRT. (At baseline, GPe provides tonic inhibition to nRT.) Tatsächlich würde im “no go” Status, der Output des indirekten Pfades GPe Neuronen inhibitieren, und gleichzeitig Neuronen im nRT disinhibitieren. Die deshalb ansteigende Aktivität im nRT kann dann des oben beschriebenen oszillatorischen Prozess initiieren. (also dadurch, dass VB Neuronen ausriechend inhibitiert warden um sie zu Bursts zu bringen.)
Die gleichen frontal-subkortikalen Schleifen im Hinblick auf Open-Loop Integration
Das Wissen wie das Gehirn in der Lage ist, den am besten passenden Plan für das Verhalten auszuwählend und zu aktivieren, wird zweifellos das Wissen und das Verstehen der Aktivitätsflusses in frontal-subkortikalen Schleifen umfassen.Mögliche kognitive und andere Aktionspläne werden in den frontalen Arealen generiert, die ein Element geschlossener Loops sind, die in den vorhergehenden Diagrammen über Schaltungen des Gehirns bereits dargestellt wurden. Die Schleife (Loop) ist geschlossen, wennProjektionen vom Thalamus das “go” Signal zurück zu den frontalen Regionen befördert hat, die es ursprünglich erzeugten. Die offenen Schleifenergänzungen zu jeder Schaltung können als Träger contextualer Information betrachtet werden. Diese Schaltungen sind manchmal begleitet von “go“ Signalen mit gleichem Einfluss aus offene und geschlossene Schleifen um Wege zu ermöglichen auf denen die Basalganglien weite Areale des Cortex koordinieren können eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen.
Ein motorisches Netzwerk
Motorische Pläne vom suplementären motorischen Kortex, die mit Statusinformationen zur Motorik vom primären motorischen und somatosensorischen Kortex im Putamen stammen, siegreichen „Go“ Signalen, die zum ventrolateralen und ventroanteriorem Thalamus gelangen und wieder zurück zum suplementären motorischen Kortex.
Um ein Beispiel zu geben: im motorischen Netzwerk warden supplementäre motorisch kortikale Pläne (BAs 6,8) Informationen zum momentanen Status des motorischen Systems zusammenkommen, die vom arcuate pörämotorischen Kortex (BA 8), dem primären motorischen Areal (BA 4) und sensomotorischen Kortices (BAs 3,1,2) stammen, um die bestmögliche Aktion einzuleiten, unter Berücksichtigung des momentanen motorischen Zustandes. Neuronen von all diesen funktional bezogenen kortikalen Arealen werden zu den teilweise überlappenden Populationen der striatalen medium spiny Neuronen (MSNs) im Putamen projezieren. Hierbei ist es von Bedeutung, dass man sich klar macht, dass eine Bündelung von Inputs, die von einer großen Zahl Cortikaler Neuronen stamen erfolgt, zu einer erheblich kleineren Anzahl von MSNs. Tatsächlich ist jedes MSN dazu bestimmt, 10000 afferente Inputs von unterschiedlichen kortikalen Arealen gleichzeitig aufzunehmen. (Lawrence, 1998).
Die erzwungene Vermischung der Inputs aus den unterschiedlichsten kortikalen Arealen auf dieselben MSN (Medium spiny Neuronen) macht die MSNs zu den geeigneten Regionen, Muster, die von Lernprozessen – durch zuvor erfolgtes verstärkendes Lernen- darüber, welcher Plan, der den gesammelten Informationen über den laufenden Prozess (sowohl von closed- und open looped Arealen stammend) der zum erfolgreichen Abschluss geeignetste ist, der dann auch zur Belohnung führt. Die MSN die die beste Kombination von Plan, Kontext und Zielen erhalten warden die aktivsten Regionen sein, die zur Ausführung des Handlungsplanes, der die Handlung aktiviert führt ( durch den Durchfluss des Circuits durch den GPi und den Thalamus, wie oben bereits beschrieben. Zur gleichen Zeit führt seine hohe AKTIVIERUNG ZUR Inhibition anderer MSNs (durch laterale Inhibition), was dazu führt, dass weniger geeignete Handlungspöläne für die anligende Situation nicht ausgeführt werden..
Ein räumliches Netzwerk
Spatial (räumliche) Information bewegt sich von posterioren parietalen und dorsolateralen präfrontalen Regionen zum Kopf des Caudate, zur internen GP/Substantia Nigra, Pars Reticulata, dann zum ventroanterioren und mediodorsalen Thalamus und zurück zum Kortex
Lawrence et al. (1998) beschrieben die originalen Circuits so, dass verschiedene Teile des lateralen präfrontalen Kortex hervorgehoben wurden. Der eher dorsale Teil, der als dorsolateraler präfrontaler Kortex beschrieben wird (DLPFC) besteht aus BA 9 und den dorsalen Aspekten der Bas 10 und 46. Der DLPFC Circuit erhält räumliche Informationen vom posterioren parietalen Kortex (PPC BA 7) und ist bekannterweise beteiligt am räumlichen Arbeitsgedächtnis, etwa der Fähigkeit, einen bestimmten Ort im Gedächtnis zu behalten, wenn der Hinweisreiz für diesen Ort verschwindet. Angemerkt werden muss, dass der PPC Teil des visuellen “Wo” Streams ist. (Der „Was“Stream liegt mehr ventral und beinhaltet den ventro-lateralen prestraaiate Kortex (Teile der Bas 18,19) und des inferioren temporal Kortex.
Eher ventral Teile der BAs 10 und 46 werden ventrolateraler prefrontal Kortex (VLPFC) genannt. Dieser Circuit erhält Objekt Informationen von inferioren und superioren temporal Gyri(IT BA20 und ST BA22) und ist beteiligt am Arbeiktsgedächtnis für Objekte. Anmerkung: dieser Tail des „Was“ visuellen Streams (Pfads) ist beteiligt am Erkennen von Objekten.
Ein visuelles Netzwerk
Visuelle Information von inferioren und superioren temporalen Regionen begegnen ventrolateralen präfrontalen Inputs am Schwanz des Caudate, dann folgen siegreichen Outputs zur internen GP/Substantia Nigra, Pars Reticulata, dann zum ventro-anterioren und mediodorsalen Thalamus, dann zurück zum VLPC
Lawrence et al. (1998) modifizierten die Vorstellung über die originalen Circuits indem sie den lateralen präfrontalen Kortex aufteilten in den eben beschriebenen VLPFC und den orbitofrontalen Kortex (OFC). Sie fügten orbitofrontale und anterior cinguläre Cortices zu einem affektiven Netzwerk zusammen, dem sie bekannte und wichtige Inputs aus der Amygdala, des Hippocampus und entorhinalen Regionen hinzugesellten.
Affektives Netzwerk
Affektive Informationen von orbitofrontalen und anterioren cingulären Regionen treffen auf Informationen vom Hippocampus, entorhinalen Regionen und der Amygdala im Nukleus Accumbens, dann folgen siegreiche Outputs zum ventralen Pallidum, zum medialen dorsalen Thalamus, dann zurück zu orbitofronateln und anterior cingulären Regionen, um Stimmung und emotionale Regionen zu kontrollieren.
Zeichnungen von Amanda Reeves, ergänzt von Kropotov, 2009 und Lawrence et al., 1998.
Affekt Netzwerk: Affektiver Informationsfluss
Einfach ausgedrückt wandern Informationen mit Bezug zum Affekt und den Emotionen vom orbitalen frontalen Kortex (OFC), über den medialen frontalen Kortex, den anterioren cingulären Kortex(ACG), den Hippocampus (HC), die Amygdala und den entorhinal Kortex (ERC), sowie das Uncus Areal zu den Basal Ganglien, inklusive des Nukleus Accumbens und des ventralen Pallidum. Von dort wandern Signale zu spezifischen, funktionell bezogenen Arealen des Thalamus, etwa den medial-dorsalen und anterioren Nuklei des Thalamus. Der Thalamus projeziert dann wieder zurück zu Arealen inklusive dem anterioren Cingulum, der Kontrollfunktionen bezüglich des affektiven Netzwerks inne hat. Das Resultat dieses Prozesses ist die Regulation von Stimmung und emotionaler Reaktion. (nach Kropotov, 2009).
Die orbitalen und medialen präfrontalen Cortices, aber auch die Amygdala sind Schlüsselareale zum Verständnis der Angst. (Davidson, 2002; Thayer, 2012), ebenso aber auch der anterior cinguläre Kortex (Matthews et al., 2004). Die Beteiligung des anterioren Cingulum an der Depression wurde bereits beschrieben.
Ebenfalls beschrieben wurden bereits andere Funktionen dieses Netzwerks: 1) die Auswahl von Zielen (Objekte und Aktionen) auf der Basis ihres subjektiven Werts und 2) die Fehlerkontrolle zugunsten eines besseren Arousal und einer erhöhten Vigilianz anzuheben, um Herausforderungen besser zu begegnen.
Anmerkungen:
Zusammenfassend: wenn kortikal-basale und ganglia-thalamocorticale gut funktionieren, wird der beste kognitive oder verhaltensrelevante Plan passend zum gegebenen Kontext, unter Einbeziehung des Gelernten und der aktuellen Ziele mit Hilfe der Basal Ganglien ausgewählt werden. Wie wir gesehen haben koordinieren die Basal Ganglien weite Areale des Kortex zu funktionalen Netzwerken. Wenn dieses System nicht optimal funktioniert, haben weder der situative Kontext noch die gewünschten Ziele den entscheidenden Einfluss sondern alte einstudierte Muster werden spontan abgerufen und dominieren. ‘Gating’ Mechanismen verlangsamen überspontane Reaktionen und erlauben potentiell geeigneteren Plänen zur Durchführung zu kommen. Komplexe Interaktionen der Basal Ganglien und der Strukturen des „Go“ und „No Go“ Pfade ermöglichen es aus vielen Handlungsmöglichkeiten die geeignete auszuwählen, fehlerhafte Handlungen zu unterbrechen und Verhaltenskontrolle im Augenblick zu üben.
![]()